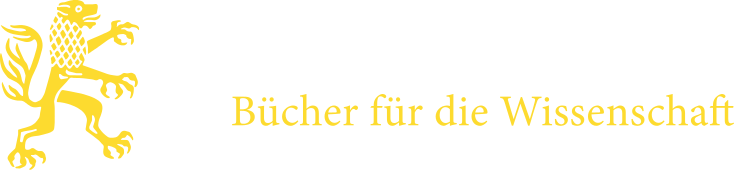Ann-Kristin Mayrhofer
Beginn und Ende der Leistungsverspätung
Normalpreis
- Artikel PDF
- lieferbar
- 10.1628/acp-2023-0045
Beschreibung
Personen
Rezensionen
Beschreibung
Die Leistungszeit als Modalität der Schuld und die Leistungsverspätung als Störung der Schuld sind zentrale Begriffe des - alten sowie neuen - Schuldrechts. Dennoch herrscht bis heute keine Einigkeit darüber, was eigentlich Bezugspunkt der Leistungszeit und damit des Beginns und des Endes der Leistungsverspätung ist. Paradebeispiel ist der Versendungskauf: Ist es für die rechtzeitige Leistung entscheidend, dass der Verkäufer die Sache abschickt oder muss diese beim Käufer ankommen oder dem Käufer gar übergeben und übereignet werden? Relevant wurde die Frage des Bezugspunkts der Leistungszeit auch in einem Urteil des BGH aus dem Jahr 2020 zur Mängelgewährleistung beim Verbrauchsgüterkauf, das den Anlass dieses Beitrags bildete. Es ging darin um die Voraussetzungen der Wahrung der Nachfrist nach §§ 437 Nr. 2, 323 Abs. 1 BGB, also um die Beendigung einer Leistungsverspätung durch eine Nachholung der Leistung.