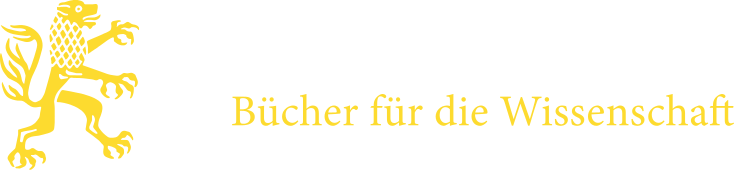Jann Maatz
Deanthropozentrierte Rechtssubjektivität
Beschreibung
Personen
Rezensionen
Beschreibung
Mit den Fortschritten der Bioinformatik und der Digitalisierung Schritt zu halten, hat sich zu einer der zentralen Aufgaben des heutigen Rechtssystems und seiner jeweiligen Teilbereiche entwickelt. Ohne sich von dem Idealbild eines technikfreien-menschlichen Individuums als einzig infrage kommendes Rechtssubjekt zu lösen, wird dies in Zukunft jedoch nicht mehr möglich sein. Die höchstrichterliche Rechtsprechung erkennt diese Notwendigkeit, wenn sie die Grenzen des menschlichen Körpers über dessen Haut und Schädeldecke hinaus erweitert und nach »funktionalen Einheiten« von Menschen und Dingen in der Welt sucht. Rechtsintern kann das dazu führen, dass Rechtssubjektivität nicht mehr ausschließlich dem Menschen aus Fleisch und Blut zugeschrieben wird, sondern möglicherweise auch nichtmenschlichen Wesen, die sich mit diesem zu einer Einheit verbunden haben. Seit der von der Europäischen Kommission im Dezember 2023 begründeten »European Virtual Human Twins Initiative«, die die Entwicklung und Implementierung von Lösungen für virtuelle menschliche Zwillinge im Gesundheits‑ und Pflegebereich unterstützen soll, verlagert sich zudem der Schutz des menschlichen Körpers über die analoge Welt hinaus in eine digitale Welt. Mit eigentumsanalogen Rechtsschutzkonzepten digitaler Körperdaten ist dem Menschen auf absehbare Zeit nicht mehr geholfen. Ein effektiver Schutz des Rechtssubjekts »Mensch« in seiner Ganzheitlichkeit, das heißt unter Einbeziehung seiner technischen Selbsterweiterungen und ‑abbildungen, ist nur durch eine Abkehr von dem traditionellen Subjekt-Objekt- Dualismus möglich und in einer »deanthropozentrierten Rechtssubjektivität« zu finden. Dann geht es um Neuaushandlungen, wem oder was der Status eines Rechtssubjekts unter geänderten gesellschaftlichen Bedingungen zukommen kann und sollte. Die Aufgabe eines technologisch-aufgeklärten Rechts ist es, die neuen »Rechtssubjektsanwärter« zu identifizieren und auf ihr Personifizierungspotential zu überprüfen.