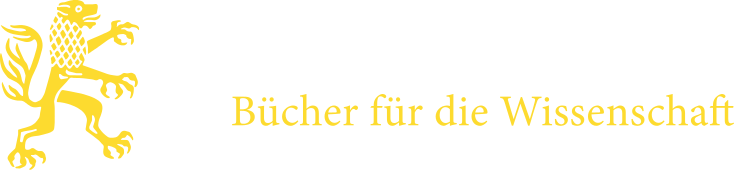Dagmar Coester-Waltjen
Die »Kinderehen«-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts: Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für das internationale Eheschließungsrecht?
Rubrik: Symposium: Grundrechte und IPR im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Kinderehenbekämpfungsgesetz
Jahrgang 87 (2023) /
Heft 4,
S. 766-785
(20)
Publiziert 13.11.2023
Beschreibung
Personen
Rezensionen
Beschreibung
Es ist zu begrüßen, dass das BVerfG im Endeffekt Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB für verfassungswidrig hält, die kollisionsrechtlichen Ausführungen bedeuten aber einen Paradigmenwechsel, der den Schutz im Ausland begründeter Statusverhältnisse reduziert und einen Geltungsanspruch der Konkretisierungen und Typisierungen des Gesetzgebers im materiellen deutschen Recht auch für Auslandssachverhalte grundsätzlich akzeptiert. Die vom BVerfG aufgezeigten Möglichkeiten, die Unverhältnismäßigkeiten der Regelung aufzufangen, dürften insbesondere auf praktische Schwierigkeiten stoßen und könnten kollisionsrechtlich kaum systemgerecht eingeordnet werden. Alternativ sollte der Gesetzgeber überlegen, ob es nicht besser wäre, auch für die »Frühestehen« nur die Aufhebbarkeit der Ehen vorzusehen, da das Unwirksamkeitsverdikt des geltenden Rechts vom Gericht zwar für grundsätzlich verfassungsrechtlich tragbar, aber keineswegs für zwingend gehalten wird. Ein Blick auf eine grundlegende Reform des Art. 13 EGBGB schließt die Betrachtung ab.