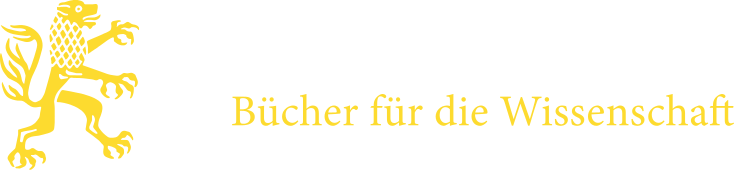Tim W. Dornis
Künstliche Intelligenz und internationaler Vertragsschluss
Beschreibung
Personen
Rezensionen
Beschreibung
Die Frage nach dem anwendbaren Recht bei Verträgen, die unter Einsatz von KI-Systemen geschlossen werden, wird erst seit Kurzem diskutiert. Bislang wird überwiegend davon ausgegangen, dass »Rechtsfähigkeit«, »Geschäftsfähigkeit« und »Stellvertretungsfähigkeit« derartiger Systeme getrennt nach Art. 7 und Art. 8 EGBGB anzuknüpfen seien und daher nicht unter die nach Art. 10 Rom I-Verordnung zu bestimmende lex causae fallen. Dieser Ansatz gründet auf der verfehlten Vorstellung einer dem menschlichen Handeln vergleichbaren persönlichen Autonomie von KI-Systemen. Wie ein genauer Blick auf die technologischen und philosophischen Grundlagen zeigt, sind algorithmische Systeme lediglich technisch autonom und damit keinesfalls als personale Akteure anzusehen. Daher können sie beim Vertragsabschluss auch lediglich die Funktion eines Werkzeugs oder Instruments ihrer Betreiber annehmen. Für das IPR bedeutet dies, dass ein KI-Einsatz bei Anbahnung und Abschluss von internationalen Verträgen umfassend dem nach Art. 10 Rom I-Verordnung zu bestimmenden Vertragsstatut unterfällt. Eine gesonderte Anknüpfung der Fragen der Rechtsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit und Stellvertretungsfähig-keit von KI-Systemen kommt nicht in Betracht.