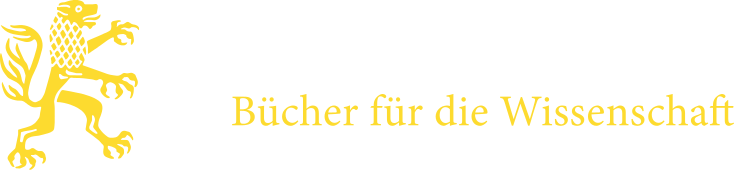Julian Philipp Rapp
Reichweite und Grenzen postmortaler Willensmacht
Normalpreis
- Artikel PDF
- lieferbar
- 10.1628/acp-2021-0028
Beschreibung
Personen
Rezensionen
Beschreibung
Ob der Tod das Ende oder erst der Anfang ist, muss gewiss jeder Einzelne für sich selbst entscheiden. Im Rechtssinne markiert das Ableben eines Menschen das Ende seiner Existenz als Rechtssubjekt; im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (§ 1922 BGB) gehen alle vererbbaren Rechtspositionen ipso iure auf die Erben über, die unvererblichen erlöschen. Über viele Jahrhunderte fokussierte sich der Regelungsgehalt des (bürgerlichen) Erbrechts daher auf die Feststellung der Erbfolge zur Verteilung der vermögenswerten Hinterlassenschaften des Erblassers sowie auf die Frage, wer für die Bestattungskosten aufzukommen hatte. Bei einer näheren Betrachtung des geltenden Rechts zeigt sich dagegen ein differenziertes Bild. Obschon der Mensch den Tod selbst noch nicht überwunden hat, hält die Rechtsordnung eine ganze Reihe an Instrumentarien bereit, durch die der Wille des Verstorbenen und dessen Rechtspersönlichkeit auch über den Tod hinaus fort bestehen können. Dem »Selbstverewigungsdrang des Menschen« zum Schutz seines Vermögens und der Bewahrung seiner Reputation kann damit post mortem zur Geltung verholfen werden.