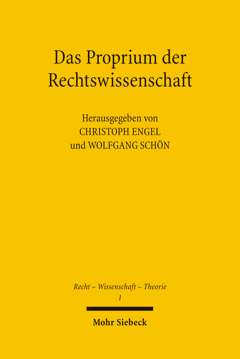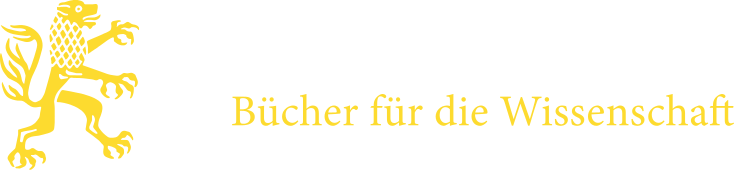Was macht das Recht zur Wissenschaft? Die Autoren der Beiträge in diesem Band gehen dieser Frage nach, die das Fach entzweit wie kaum eine andere. Was sich der Brauchbarkeit für die Praxis verweigert, ist keine Juristerei mehr, sagen die einen. Was sich den Standards der Sozialwissenschaften verweigert, ist keine Wissenschaft mehr, sagen die anderen.
Was macht Recht zur Wissenschaft? Dieser Frage gehen die Autoren der hier gesammelten Aufsätze nach. Die Juristerei ist eine selbstbewusste Disziplin. Die offensichtliche praktische Bedeutung des Fachs bietet ihr Schutz vor Selbstzweifeln. Der Hunger der Praxis nach Heerscharen gut ausgebildeter Juristen tut ein Übriges. Doch im universitären Wettbewerb der Fächer sind beides eher schwache Argumente. Noch beunruhigender ist, dass viele dogmatische Argumente auf sozialwissenschaftlichen Konzepten gründen. Schon in der Rechtsanwendung führt dies zu Friktionen: Ein Gericht kann weder mit einem exakten mathematischen Modell etwas anfangen noch mit Regressionen, die so gut spezifiziert sind, dass der Fehlerterm normalverteilt ist. Wenn man die Juristerei für harte Sozialwissenschaften öffnet, kommt das Fach also nicht ohne Vermittler aus. Noch prekärer ist die Lage in der Rechtspolitik: Können Juristen den Gesetzgeber mit eigener wissenschaftlicher Autorität beraten oder lassen sich die Regelungsziele guter Gesetzgebung besser aus der Perspektive von Ökonomen, Psychologen oder Soziologen definieren? Die traditionell fraglose Einheit von Wissenschaft und Praxis wird zu einem voraussetzungsvollen Unterfangen. Nicht zuletzt mag manch ein juristischer Wissenschaftler versucht sein, sich ganz auf die Position des Beobachters zurückzuziehen. Dann ist das Recht bloß noch Forschungsgegenstand. Einen Beitrag zur Entwicklung der Dogmatik will solch ein Wissenschaftler nicht mehr leisten. Dies führt zu der Frage nach der Eigenständigkeit der Rechtslehre im Konzert der Wissenschaften - der Frage nach dem »Proprium der Rechtswissenschaft«.
Inhaltsübersicht:
1) ZivilrechtWolfgang Ernst: Gelehrtes Recht. Jurisprudenz aus der Sicht des Zivilrechtslehrers -
Holger Fleischer: Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht als wissenschaftliche Disziplin. Das Proprium der Rechtswissenschaft -
Wolfgang Fikentscher: Wissenschaft und Recht im Kulturvergleich (Kommentar zu Wolfgang Ernst und Holger Fleischer) -
Mathias Reimann: Die Propria der Rechtswissenschaft (Anmerkungen zu Wolfgang Ernst und Holger Fleischer)
2) StrafrechtGünther Jakobs: Strafrecht als wissenschaftliche Disziplin -
Joachim Schulz: Die Strafrechtsdogmatik nach dem Ende der vor- und außerjuristischen Gerechtigkeit -
Wolfgang Frisch: Wesenszüge rechtswissenschaftlichen Arbeitens - am Beispiel und aus der Sicht des Strafrechts (Kommentar zu Günter Jakobs und Joachim Schulz) -
Winfried Hassemer: Das Proprium der Strafrechtswissenschaft (Kommentar zu Günter Jakobs und Joachim Schulz) -
Stephan Tontrup: Zum unterschiedlichen Verhältnis der juristischen Teilfächer zu den Sozialwissenschaften (Kommentar zu Günther Jakobs und Joachim Schulz)
3) Öffentliches RechtChristoph Engel: Herrschaftsausübung bei offener Wirklichkeitsdefinition. Das Proprium des Rechts aus der Perspektive des öffentlichen Rechts -
Matthias Jestaedt: »Öffentliches Recht« als wissenschaftliche Disziplin -
Gertrude Lübbe-Wolff: Expropriation der Jurisprudenz? (Kommentar zu Christoph Engel und Matthias Jestaedt) -
Christoph Grabenwarter: Das Proprium der Rechtswissenschaft - Öffentliches Recht (Kommentar zu Christoph Engel und Matthias Jestaedt) -
Stefan Magen: Entscheidungen unter begrenzter Rationalität als Proprium des öffentlichen Rechts (Kommentar zu Christoph Engel und Matthias Jestaedt)
4) SchlusskapitelWolfgang Schön: Quellenforscher und Pragmatiker - Ein Schlusswort