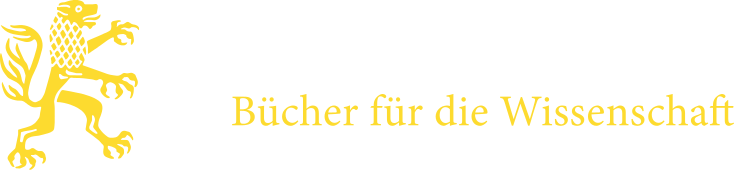Jeder hätte sie gern, viele kämpfen darum, manche scheinen sie zu 'haben' - aber bisher ist weitgehend ungeklärt, was das ist: Deutungsmacht. Wie entsteht, funktioniert und vergeht sie? Was für Macht entwickeln Deutungen? Wann und warum werden sie anerkannt oder auch nicht mehr? Dieses gängige Konzept wird in den Beiträgen näher ausgearbeitet und in Fallstudien bearbeitet.
Jeder hätte sie gern, viele kämpfen darum, manche scheinen sie zu 'haben' - aber bisher ist weitgehend ungeklärt, was das ist:
Deutungsmacht. Wie entsteht, funktioniert und vergeht sie, exemplarisch im Kontext von Religion und belief systems? Was für Macht entwickeln Deutungen? Wann und warum werden sie anerkannt oder auch nicht mehr? Dieses gängige Konzept der »Deutungsmacht« wird in den Beiträgen begrifflich näher ausgearbeitet und mit Fallstudienmaterial bearbeitet.
Aktuell besonders relevant ist die Tatsache, dass die Pluralisierung von Ordnungen einher geht mit Deutungsmachtpluralisierung. Der Anspruch einer Deutung auf Anerkennung und Geltung wird explizit und begründungsbedürftig im Streit verschiedener Deutungen um Macht. Vermutlich wird in jeder Kommunikation im Konfliktfall ein Deutungsmachtkonflikt ausgetragen. Die gesellschaftliche Relevanz solcher 'Arbeit an Deutungsmacht' besteht in der Differenzierung des Verstehens kultureller Deutungsmachtkonflikte, das der Verständigung und Bearbeitung derselben förderlich werden kann.
Inhaltsübersicht:
Philipp Stoellger: Deutungsmachtanalyse. Zur Einleitung in ein Konzept zwischen Hermeneutik und Diskursanalyse
I. TheorienHeiner Hastedt: Was ist 'Deutungsmacht'? Philosophische Klärungsversuche -
Emil Angehrn: Die Differenz des Sinns und der Konflikt der Interpretationen -
Werner Stegmaier: Von Religionsstiftern lernen: Deutungsmacht als Kraft zur Orientierung -
Marc Rölli: Wissen und Verstehen. Zur Analyse der Macht epistemischer und hermeneutischer Strukturen -
Burkhard Liebsch: Interpretationsmacht. Macht der Interpretation und Interpretation der Macht − in der Perspektive einer Revision des Politischen
II. SchriftenEckart Reinmuth: Performativität und Gewalt im Hebräerbrief -
Marius Timmann Mjaaland: Der apokalyptische Zwerg der Revolution -
Jens Wolff: The Power of Philology Between Sacralisation and Poetic and Aesthetic Semi-Secularisation -
Philip Manow: Der politische Kampf um theologische Deutungsmacht - das Ende der Divine Right Doctrine und der protestantische Ikonoklasmus im Englischen Bürgerkrieg
III. GeisterGesa Mackenthun: Fossils and Immortality. Geological Time and Spiritual Crisis in Nineteenth-Century America -
Klaus Hock: Der entgeisterte Blick: Geist(er)besessenheit im Religionsdiskurs. Übergänge - Bruchlinien - Verschränkungen
IV. MythenStephanie Wodianka: Nur ein Mythos? Konfliktpotentiale des Mythischen in der Moderne -
Yves Bizeul: Der Kampf um die Deutungsmacht in der Spätmoderne am Beispiel des Mythos des Clash of Civilizations
V. Recht, Ökonomie und GesellschaftPeter A. Berger: Bilder sozialer Ungleichheit. Zur Versozialwissenschaftlichung sozialer Deutungsmuster -
Birger P. Priddat: Oeconomia perennis. Drei Stationen der Geburt der Ökonomie aus der Theologie. Wechsel der Deutungsmacht -
Hans Michael Heinig: Deutungsmachtkonflikte als Deutungs- und Machtkonflikte im Religionsrecht
VI. ChristentümerPhilipp Stoellger: Theologie als Deutungsmachttheorie. Zur Hermeneutik von Deutungsmacht im systematischen Diskurs -
Thomas Klie: Deutungsmachtkonflikte angesichts des Todes -
Martina Kumlehn: Deutungsmacht und Deutungskompetenz - Deutungskonflikte im Kontext religiöser Bildung