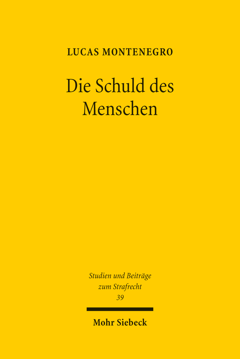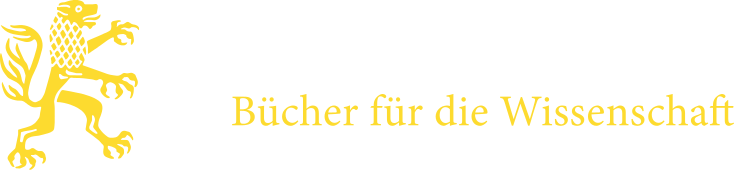Affekte werden überwiegend als ein Hindernis für strafrechtliche Schuld angesehen. Diese Ansicht vereinfacht die Komplexität von Emotionen und kann keine angemessene Lösung für konkrete Fälle anbieten. Dies zu zeigen und eine alternative Auffassung von Emotionen und Schuld zu entwickeln, ist das Ziel der vorliegenden Untersuchung.
Wie sollte man mit Menschen umgehen, die unter starkem Affekt eine Straftat begehen? Einer verbreiteten Ansicht zufolge verlieren Affekttäter die Beherrschung über sich selbst und können ihr Verhalten nicht ganz verantworten. So wirkt sich der Affekt auf die Schuld des Täters aus mit der Folge einer Strafmilderung oder sogar eines Freispruchs. Lucas Montenegro unterzieht diese Ansicht einer umfassenden Kritik, die bis in die Grundlagen strafrechtlicher Schuld reicht. Durch die Analyse wird aufgezeigt, wie die heute im Strafrecht herrschende Auffassung über Affekt auf einer Vereinfachung der Rolle von Emotionen bei der Erklärung von Handlungen und der Zuschreibung von Verantwortung beruht. Die gewonnenen Erkenntnisse bereiten den Boden für die Entwicklung eines eigenen Konzepts strafrechtlicher Schuld, das besser in der Lage wäre, Emotionen in ihrer Komplexität zu erfassen.
Inhaltsübersicht:
A. EinführungI. Emotionen im Strafrecht
II. Emotionen und Schuld
III. Menschenbild, Strafe und Schuld
IV. Ziel und Gang der Untersuchung
B. Affekt und Schuld im Strafrecht: Das herrschende BildI. Vorüberlegungen: Affekt, Schuld und Empirie
II. Der Affekt der Affekttaten
III. Die Schuldlehre hinter den pathologischen Affekten
IV. Zwischenfazit
C. Pathologische Affekte: Eine KritikI. Affekt und Schuldfähigkeit
II. Affekte beim entschuldigenden Notstand
III. Die Affekte des § 33 StGB
IV. Zorn und Überlegung bei Tötungsdelikten
V. Zwischenfazit
D. Emotionen und Verantwortung: Ein komplexeres BildI. Nicht-rationale Zustände?
II. Emotionen: Im »Haus der Vernunft«
III. Verantwortlichkeit und Emotionen
IV. Ein Wort zur ewigen Frage
V. Zwischenfazit
E. Ansätze einer naturalistischen SchuldtheorieI. Menschennatur in der Tradition strafrechtlichen Denkens
II. Menschennatur und Strafe
III. Die Schuld des Menschen
F. Schuld und Emotionen: Dogmatischer ErtragI. Leitlinien zur Bewertung von Emotionen
II. Einzelne Konstellationen
G. Zusammenfassung