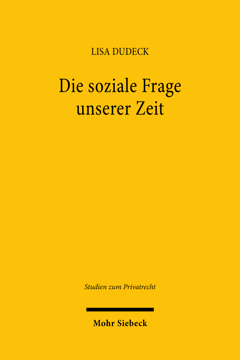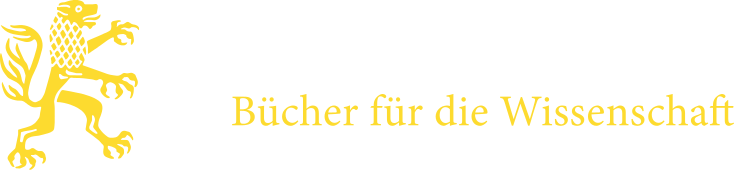Bezahlbares Wohnen ist eine der dringlichsten sozialen Fragen unserer Zeit - und sie wird sich mithilfe des BGB nicht lösen lassen. Lisa Dudeck legt offen, wie das Vertragsrecht mit gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitischen Zielen aufgeladen wird, die sich kaum abbilden lassen, während das weitaus größere Gestaltungspotenzial alternativer Regelungsmechanismen ungenutzt bleibt.
Bezahlbares Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Lösungsversuche konzentrieren sich seit Jahrzehnten auf das Schuldvertragsrecht des BGB, sei es in Form der ortsüblichen Vergleichsmiete, der Kappungsgrenze oder der »Mietpreisbremse«. Damit sind Gesetzgeber, Rechtsprechung und Wissenschaft nicht gut beraten. Denn der starke Fokus auf die privatrechtliche Beziehung von Mieter und Vermieter führt dazu, dass das Vertragsrecht mit einer Vielzahl gesellschafts-, sozial-, wirtschafts- und umweltpolitischer Ziele aufgeladen wird, die sich darin kaum sachgerecht abbilden lassen. Sowohl im Zivil- als auch im Verfassungsrecht werden dadurch Schutzrechte des Mieters konstruiert, die dessen Freiheitschancen auf dem Markt tatsächlich nicht erhöhen. Währenddessen bleiben alternative Regelungsmechanismen unberücksichtigt, die ein weitaus größeres Gestaltungspotenzial auf dem Wohnungsmarkt entfalten können - und namentlich im öffentlichen Recht zu finden sind.
Inhaltsübersicht:
A. Einführung und methodische Vorüberlegungen
Hinführung zum Thema der Untersuchung
Vorüberlegungen zur Forschungsgegenstand und Methode
Stand der Forschung
Gang der Darstellung
B. Die langen Schatten der Wohnungszwangswirtschaft - Vorläufer des bundesrepublikanischen Mietrechts
Ausgangslage - Die »Wohnungsfrage«
Wohnungsfrage und Bürgerliches Gesetzbuch
Beginn staatlicher Mietpreisregulation im Ersten Weltkrieg
Preußischer »Mietendeckel« und die »Grundgesetze« der Wohnungszwangswirtschaft
Mietpreise als Teil der nationalsozialistischen Volkswirtschaft
Der Übergang zum bundesrepublikanischen Mietpreisrecht
C. Zwecke staatlicher Mietpreisregulation
»Diese entsetzliche Wohnungsnot« - Wiederaufbau und Wohnungspolitik in den 1950er Jahren
Der »Lücke-Plan« - Liberalisierungsversuche in den 1960er Jahren
Vom »Ausgleich sozialer Härtefälle« zum »sozialen Dauerrecht«
Forderung nach mehr Markt und Vertrag in den 1980er und 1990er Jahren
»Ausgewogene Siedlungsstrukturen« - Sozial- und siedlungspolitische Ziele im Mietrecht ab 2001
D. Kontrastfolie: Tatsächliche Entwicklung des Wohnungsmarktes in der Bundesrepublik
Gescheitertes Ideal breiter Eigentumsbildung
Vorstoß und Rückzug des Staates als wohnungspolitischer Akteur
Der begrenzte Einfluss staatlicher Regulierung auf die tatsächliche Mietersituation
E. »Gerechte Miete« und Rechtswissenschaft
Eigentumsfreiheit im Mietverhältnis - Wirkung der Grundrechte im Privatrecht
Verarbeitung im privatrechtlichen Diskurs
F. Bezahlbarer Wohnraum als Regelungsproblem außerhalb des Mietvertragsrechts
Geltendes Recht: Bezahlbarer Wohnraum als Regelungsproblem außerhalb des BGB
Öffentlich-rechtliche Vorstöße auf Landesebene
Exkurs: Klimaschutz und Digitalisierung als Neuordnungsfaktoren? - Das Beispiel der 15-Minuten-Stadt
G. Schlussbemerkung und Zusammenfassung in Thesen