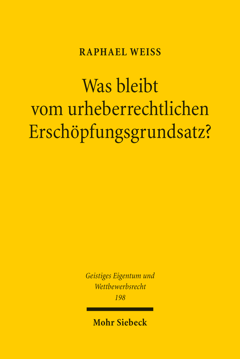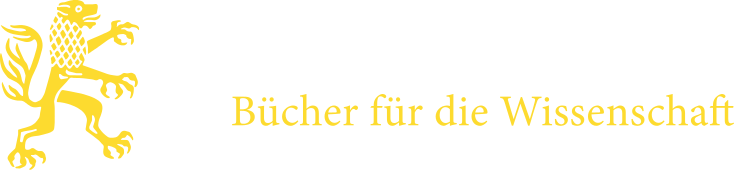Die Rechtsstellung der Nutzer beim Konsum urheberrechtlich geschützter Inhalte hat sich durch die Digitalisierung drastisch verschlechtert. Raphael Weiß analysiert die rechtlichen Herausforderungen und zeigt innovative Ansätze, wie Verbraucherrechte gestärkt und der Weitervertrieb trotz urheberrechtlicher Grenzen ermöglicht werden können.
Die Digitalisierung hat grundlegend verändert, wie wir Filme, Serien und Musik konsumieren – weg vom Kauf physischer Trägermedien hin zu Streaming- und Abomodellen. Diese Veränderung in der Art der Werknutzung geht mit einer schwächeren rechtlichen Position der Nutzer einher, die ihre Medien nicht mehr weiterveräußern können. Der Gesetzgeber will dem entgegenwirken und hat mit Umsetzung der Digitale-Inhalte-Richtlinie das Ziel ausgegeben, den Weitervertrieb digitaler Inhalte zu ermöglichen, dabei aber die maßgeblichen urheberrechtlichen Vorschriften unangetastet gelassen. Raphael Weiß betrachtet den Weitervertrieb digitaler Inhalte in Abhängigkeit vom jeweiligen Geschäftsmodell auf schuldrechtlicher, sachenrechtlicher, urheberrechtlicher und kartellrechtlicher Ebene und entwickelt unter Berücksichtigung der normativen Verbrauchererwartung ein Recht auf Weitervertrieb aus dem objektiven Mangelbegriff.
Inhaltsübersicht:
EinführungA. Anlass und Gegenstand der Untersuchung
B. Die Entwicklung der Vertriebsmodelle
C. Forschungsfrage
D. Gang der Darstellung
Teil 1: Der Vertrieb physischer WerkexemplareA. Der Erschöpfungsgrundsatz
B. Abgrenzung zum Vervielfältigungsrecht
C. Der Erschöpfungsgrundsatz und der spezifische Gegenstand des Urheberrechts
D. Ergebnis zu Teil 1
Teil 2: Die Verkehrsfähigkeit digitaler Inhalte im Rahmen eines einmaligen LeistungsaustauschsA. Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes im Online-Bereich
B. Urheberrechtliche Relevanz von Nutzungshandlungen
C. Schuldrechtliche Ebene
D. Dingliche Ebene
E. Alternative Lösungsmöglichkeiten
F. Ergebnis zu Teil 2
Teil 3: Die Verkehrsfähigkeit digitaler Inhalte im Rahmen von DauerschuldverhältnissenA. Grundlegendes
B. Urheberrechtliche Relevanz von Nutzungshandlungen
C. Schuldrechtliche Ebene
D. Dingliche Ebene
E. Alternative Lösungsmöglichkeiten
F. Ergebnis zu Teil 3
Teil 4: Kartellrechtliche BeurteilungA. Ökonomische Besonderheiten von digitalen Plattformmärkten
B. Anwendung des Kartellrechts auf Rechte des geistigen Eigentums
C. Kartellverbot, Art. 101 AEUV
D. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, Art. 102 AEUV
E. Anwendung des Digital Markets Act
F. Ergebnis zu Teil 4
FazitA. Der Erschöpfungsgrundsatz – Relikt der analogen Zeit?
B. Zusammenfassung in Thesen