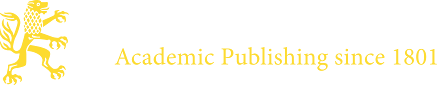J. Albert Harrill
Atheist Catalogues as an Organizing Technique in Classical Literary Culture
- article PDF
- available
- 10.1628/ec-2020-0014
Summary
Authors/Editors
Reviews
Summary
Der Artikel untersucht antike Atheistenkataloge nicht im Blick auf »Ursprünge« und Entwicklung des antiken Atheismus, sondern als eine spezifische Organisationsform in der klassischen Literatur. Diese Praxis diente dazu, Wissen in bestimmte Hierarchien einzuordnen und für die protreptische Rede nutzbar zu machen. Sie führte eine Reihe fester Termini in die Selbstdefinition ein, die aber auch genau umgekehrt verwendet wurden: Der Ausdruck ἄθεοι (»Atheisten«) diskreditierte andere als Anhänger einer falschen Meinung. Der Vorwurf wurde zahlreichen antiken Gruppen gemacht – von Sokratikern und Epikureern bis hin zu Juden und Christen -, deren Schriften dann ein gemeinsames Muster apologetischer Antworten bezeugen, um die Anschuldigungen zurückzuweisen. Solche protreptischen Diskurse zielten darauf, die eigene Gemeinschaft vom Etikett des Atheismus zu befreien und sich selbst als Anti-Atheisten darzustellen. Die Bezeichnung von Außenstehenden als Atheisten in frühchristlichen Schriften bricht also nicht mit einer verbreiteten kulturellen Praxis der antiken Literatur, sondern knüpft erkennbar an sie an.